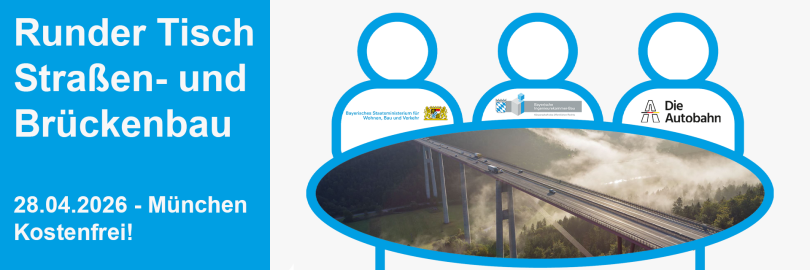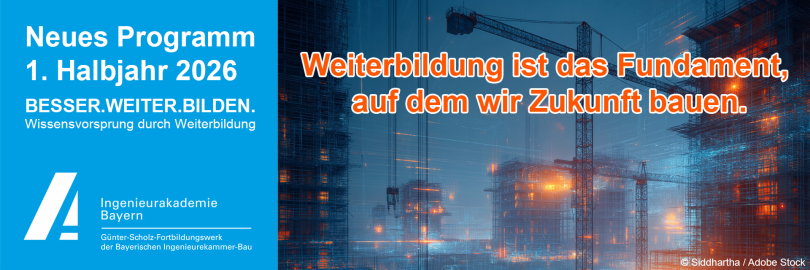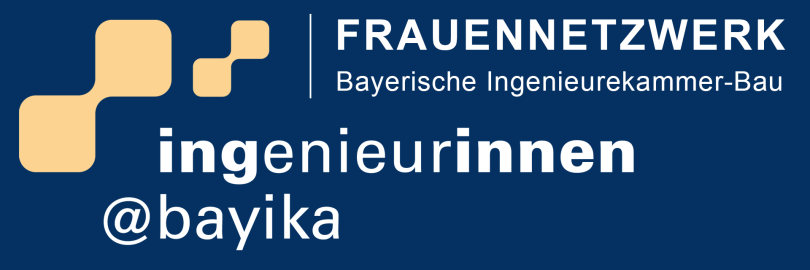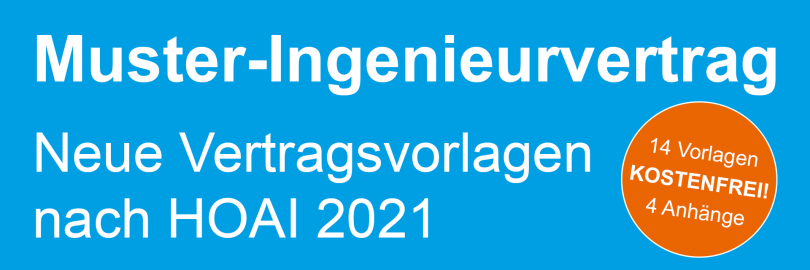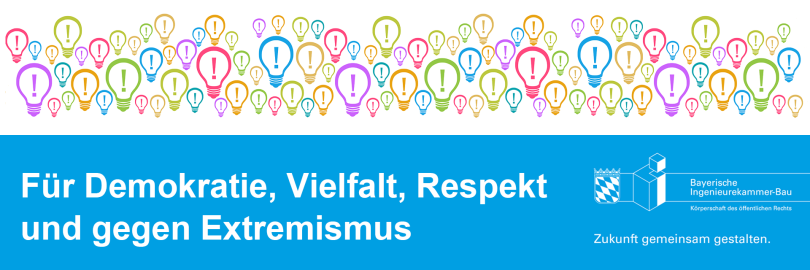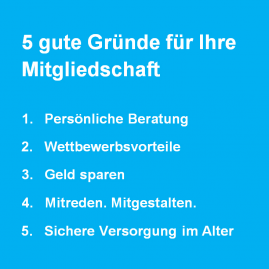Bundestag beschließt Novelle des Gebäudeenergiegesetzes
Startschuss für klimafreundliches Heizen
11.09.2023 - Berlin

Der Bundestag hat die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beschlossen. Das Gesetz ist der Startschuss für den Umstieg aufs Heizen mit Erneuerbaren Energien. Es leitet eine umfassende Modernisierung der Wärmeversorgung in Deutschland ein: Mit mehr Fernwärme und effizienterer, sparsamerer und klimafreundlicher Heiztechnologie gehe damit die Wärmepolitik in Deutschland nach Jahren des Stillstandes auf einen zukunftsfähigen Kurs.
Verbraucherinnen und Verbraucher, Wohnungswirtschaft, Heizungsindustrie und Handwerk haben mit den neuen Regelungen eine klare Richtschnur für ihre Investitionsentscheidungen. So können Erneuerbare Energien im Gebäudebereich zum Standard werden und Schritt für Schritt klimaschädliche Heizungen auf Basis von Erdgas oder Erdöl ersetzen. Klimaschutz und Energiesicherheit kommen mit diesem Gesetz Jahr für Jahr verlässlich voran.
Damit beim Umstieg auf eine zeitgemäße Heizung niemand überfordert wird, gibt es ausreichende Übergangsfristen sowie Härtefallregelungen und eine Förderung für den Heizungstausch von bis zu 70%. Die Fristen harmonieren mit den geplanten Vorgaben für die Erstellung von Wärmeplänen nach dem Wärmeplanungsgesetz. Eigentümerinnen und Eigentümer können beim Umstieg auf erneuerbare Energien frei zwischen unterschiedlichen Technologien wählen. Bestehende Öl- und Gasheizungen sind nicht von der Regelung betroffen und können weiter genutzt werden.
Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck: „Wir haben monatelang intensiv über dieses Gesetz debattiert, und die vielen Diskussionen und Gespräche haben dieses Gesetz besser gemacht. Nun können wir sagen: Das Gesetz ist eine zentrale Weichenstellung für den Klimaschutz. Wir werden unabhängiger von fossiler Energie und stärken so die Energiesicherheit. Wir schützen Verbraucherinnen und Verbraucher vor steigenden Preisen für Erdgas und Erdöl. Und wir setzen einen Impuls für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bei grünen Technologien. Zentral ist, dass wir die Bürgerinnen und Bürger bei den anstehenden Investitionen mit unserer Förderung unter die Arme greifen, so dass sie sich den Umstieg leisten können. Es gibt in Zukunft bis zu 70% Förderung für den Heizungstausch, um insbesondere Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen zu unterstützen. Das ist wichtig.“
Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Klara Geywitz: „Nach den intensiven Diskussionen der letzten Monate um das sog. „Heizungsgesetz“ freue ich mich, dass dieses heute vom Deutschen Bundestag beschlossen worden ist und im Ergebnis ein wirklich gutes Gesetz geschaffen wurde. Es bringt uns dem Ziel der Klimaneutralität 2045 ein gutes Stück näher, ohne dabei die Eigentümer und Mieter zu überfordern. Das Gesetz bietet echte Technologieoffenheit. Durch die Verknüpfung mit der kommunalen Wärmeplanung gibt es den Gebäudeeigentümern die Möglichkeit, sich bei der Entscheidung für eine klimafreundliche Heizung an den Inhalten der Wärmepläne zu orientieren und schafft so nach und nach Planungs- und Investitionssicherheit. In Verbindung mit den erweiterten gesetzlichen Erfüllungsoptionen und den großzügigen Übergangsfristen hat jeder Gebäudeeigentümer die Möglichkeit, die für ihn passende und sachgerechte Option zur Erfüllung der 65%EE-Vorgabe zu wählen, egal, ob er auf dem Land oder in der Stadt wohnt.“
Kurzüberblick
- In Neubaugebieten muss ab dem 1.1.2024 jede neu
eingebaute Heizung mindestens 65% erneuerbare Energie nutzen.
- Für Bestandsgebäude und Neubauten, die in
Baulücken errichtet werden, gilt diese Vorgabe abhängig von der Gemeindegröße
nach dem 30.06.2026 bzw. 30.06.2028. Diese Fristen sind angelehnt an die im
Wärmeplanungsgesetz vorgesehenen Fristen für die Erstellung von Wärmeplänen. Ab
den genannten Zeitpunkten müssen neu eingebaute Heizungen in Bestandsgebäuden
und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten die Vorgaben des Gesetzes erfüllen.
Um es den Eigentümern zu ermöglichen, die für sie passendste Lösung zu finden, kann
für eine Übergangsfrist von fünf Jahren noch eine Heizung eingebaut werden, die
die 65%EE-Vorgabe nicht erfüllt.
- Bestehende Heizungen sind von den Regelungen
nicht betroffen und können weiter genutzt werden. Auch wenn eine Reparatur
ansteht, muss kein Heizungsaustausch erfolgen.
- Der Umstieg auf Erneuerbare erfolgt
technologieoffen. Bei einem Heizungseinbau oder -austausch können Eigentümer
frei unter verschiedenen Lösungen wählen: Anschluss an ein Wärmenetz,
elektrische Wärmepumpe, Stromdirektheizung, Biomasseheizung, Hybridheizung
(Kombination aus Erneuerbaren-Heizung und Gas- oder Ölkessel), Heizung auf der
Basis von Solarthermie und „H2-Ready“-Gasheizungen, also Heizungen, die auf 100
Prozent Wasserstoff umrüstbar sind. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es
einen rechtsverbindlichen Investitions- und Transformationsplan für eine
entsprechende Wasserstoffinfrastruktur vor Ort gibt.
- Daneben ist jede andere Heizung auf der Grundlage
von Erneuerbaren Energien bzw. eine Kombination unterschiedlicher Technologien
zulässig. Dann ist ein rechnerischer Nachweis für die Erfüllung des
65%-Kriteriums zu erbringen.
- Um auch bei Öl- und Gasheizungen, die ab dem
1.1.2024 eingebaut werden, den Weg Richtung klimafreundliches Heizen
einzuschlagen, müssen diese ab dem Jahr 2029 stufenweise ansteigende Anteile
von grünen Gasen oder Ölen verwenden: Ab dem 1.1.2029 15 %, ab dem 1.1.2035 30
% und ab dem 1.1.2040 60 %.
- Das Gebäudeenergiegesetz enthält weitere
Übergangsregelungen, z.B. wenn der Anschluss an ein Wärmenetz in Aussicht
steht, und eine allgemeine Härtefallregelung, die auf Antrag Ausnahmen von der
Pflicht ermöglicht. Im Einzelfall wird dabei etwa berücksichtigt, ob die
notwendigen Investitionen in einem angemessenen Verhältnis zum Ertrag oder in
einem angemessenen Verhältnis zum Wert des Gebäudes stehen. Auch
Fördermöglichkeiten und Preisentwicklungen fließen hier ein. Aber auch aufgrund
von besonderen persönlichen Umständen, wie etwa einer Pflegebedürftigkeit, kann
eine Befreiung von der Pflicht zum Heizen mit Erneuerbaren gewährt werden.
- Für den Umstieg aufs Heizen mit Erneuerbaren gibt
es finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen, Krediten oder steuerlicher
Förderung. So sind bis zu 70% Förderung möglich. Alle Antragstellenden können
eine Grundförderung von 30% der Investitionskosten erhalten. Haushalte im
selbstgenutzten Wohneigentum mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von
unter 40.000 Euro erhalten noch einmal 30% Förderung zusätzlich
(einkommensabhängiger Bonus). Außerdem ist für den Austausch alter Heizungen
ein Klima-Geschwindigkeitsbonus von 20% bis 2028 vorgesehen, welcher sich ab
2029 alle 2 Jahre um 3 Prozentpunkte reduziert. Die Boni sind kumulierbar bis
zu einer maximalen Förderung von 70%.
- Zusätzlich ist neu ein Ergänzungskredit für
Heizungstausch und Effizienzmaßnahmen bei der KfW erhältlich, bis zu einem
Jahreshaushaltseinkommen von 90.000 Euro zinsverbilligt. Sonstige energetische
Sanierungsmaßnahmen werden weiterhin mit 15% (bei Vorliegen eines individuellen
Sanierungsfahrplans mit 20%) Investitionskostenzuschuss gefördert. Auch die
Komplettsanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden auf ein Effizienzhaus-Niveau
sowie alternativ die steuerliche Förderung bleiben unverändert erhalten.
- Dazu wird jetzt die Bundesförderung für
effiziente Gebäude (BEG) novelliert und soll gemeinsam mit dem GEG zum 1.1.2024
Inkrafttreten.
- Durch die weitreichende Förderung des Heizungsaustauschs werden auch die Mieterinnen und Mieter vor hohen Mietsteigerungen geschützt, denn die Fördermittel müssen von den Kosten der Modernisierungsmaßnahme abgezogen werden. Dadurch kommt die Förderung den Mieterinnen und Mietern zu Gute, da die Modernisierungsmieterhöhung entsprechend geringer ausfällt. Zusätzlich gilt eine Kappungsgrenze von 50 Cent pro Quadratmeter für alle Heizungsaustausche. Damit ist sichergestellt, dass durch die Beteiligung des Staates an Kosten der Wärmewende Mieterhöhungen auf das erforderliche Maß begrenzt werden.
Quelle: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Foto: DifferR / AdobeStock
Kommentare
Verband Beratender Ingenieure VBI
Der Bundestag hat am 08.09.2023 die letzte, viel diskutierte Novelle zum GEG verabschiedet. Zentraler Punkt ist eine Anpassung von § 71 des Gesetzes. Dabei wird geregelt, welche Art von Heizlösung in Zukunft verbaut werden darf. Wie bereits im Koalitionsvertrag der Regierung festgehalten, sollen in Zukunft nur noch Heizungen verbaut werden, die sich zu 65 % aus erneuerbaren Energien speisen. Direkt ab dem 1.1.2024 betroffen sind Neubauten in Neubaugebieten (Zeitpunkt des Bauantrags). Für alle anderen Neubauten und Bestandsgebäude kommt es darauf an, ob bereits eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Kommunen ab 100.00 Einwohnern müssen diese bis zum 30.06.2026 vorlegen, kleine Kommunen haben bis zum 30.06.2028 dafür Zeit. Liegt eine kommunale Wärmeplanung vor, gilt die 65-Prozent-Pflicht einen Monat nach Bekanntgabe durch die Kommune.
Das Gesetz ist durchaus technologieoffen gestaltet. Neben einem Anschluss an ein Wärmenetz, Wärmepumpen und Stromdirektheizungen sind auch Heizlösungen mit Biomasse und Wasserstoff möglich. Es dürfen weiterhin auch Gasheizungen verbaut werden, wenn diese auf die Verbrennung von Wasserstoff umrüstbar sind und das Gebäude in einem Wasserstoffnetzausbaugebiet liegt. Schließlich sind auch Hybridlösungen erlaubt, also beispielsweise eine Wärmepumpe mit einer kleinen Gasheizung zur Warmwasserbereitung.
Der Gesetzesentwurf sieht auch eine Reihe von Sonder- und Härtefällen vor, unter anderem für Etagenheizungen, soziale Härtefälle und Regelungen zur Nutzung gebrauchter Gasheizungen als Übergangslösung.
Wichtig ist nun, wieder Vertrauen bei den Bauherren herzustellen. Der politische Streit der letzten Monate hat zu großer Verunsicherung geführt und letztlich zu einem starken Rückgang der Nachfrage nach Wärmepumpen. Langfristig werden die Kosten für Gas und Öl weiter steigen und sich erneuerbare Energien voraussichtlich als die wirtschaftlichste Lösung herauskristallisieren. Investitionen im TGA Bereich sind mit hohen Kosten verbunden. Die Regierung muss jetzt glaubhaft für Planungssicherheit sorgen und vor allem ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Nur so kann die Energiewende im Gebäudesektor zum Erfolg werden.
Quelle: Verband Beratender Ingenieure VBI
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Zukünftige Anpassungen müssen die Baupraxis im Blick haben
„Es ist gut, endlich einen Knopf an das Gesetz zu machen. Weitere Diskussionen würden die Baunachfrage zusätzlich verzögern. In seinen Details ist das Gesetz aber verbesserungswürdig. Spätestens nachdem die EU-Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie beschlossen wird, muss das GEG ohnehin erneut überarbeitet werden. Wir hoffen sehr auf Anpassungen, die die Baupraxis besser im Blick haben. Eine zukünftige Diskussion ist mit ausreichend Zeit, Ruhe und Sachlichkeit zu führen, dass das Gesetz sowohl die Gebäudeenergieeffizienz als auch die Baukonjunktur stärkt.“
Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB)
Quelle: Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW)
Eine sehr große Enttäuschung
„Das GEG ist eine einzige große und andauernde Enttäuschung für die sozialen Vermieter. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde durch ein Gesetz so viel Vertrauen in die Politik und in die Demokratie verspielt. Auch in der am Freitag im Bundestag verabschiedeten Fassung verursacht das Gesetz für die am Gemeinwohl orientierten und sozialen Vermieter hohe finanzielle Lasten. Die im VNW organisierten Unternehmen werden in den kommenden Jahren Hunderte Millionen Euro, wenn nicht gar Milliarden Euro in den Heizungskeller investieren müssen. Das ist Geld, das für die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen fehlt – sowohl im Bestand als auch im Neubau. Die sozialen Vermieter unterstützen das Ziel, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Aber Klimaschutz braucht die Unterstützung der Menschen. Mit diesem Gesetz wird diese Unterstützung verspielt, weil es zu Lasten der Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen geht. Klimaschutz ist immer auch eine soziale Frage. Wer das vergisst, wird am Ende scheitern.“
Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW)
Quelle: Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW)
VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.
Gebäudeenergiegesetz GEG: VDI sieht in kommunaler Wärmeplanung die Basis
Am Freitag verabschiedet der Deutsche Bundestag nach langwierigen und kontroversen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen endlich das Gebäudeenergiegesetz GEG sowie damit zusammenhängende Gesetze. Der VDI begrüßt, dass damit auch die Wärmewende ein wichtiges Stück vorankommt. Ohne eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende im Wärmesektor ist das Ziel der Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 nicht zu erreichen. Die Wärme- und Kälteversorgung weist mit 56 % den größten Teil am Endenergiebedarf auf. Bislang ist der Anteil der erneuerbaren Energien an der Wärmeversorgung mit 17,4 % noch sehr gering.
Grundlage der notwendigen Transformation des Wärmesektors ist daher eine möglichst flächendeckende kommunale Wärmeplanung. Dies hat die Bundesregierung mit der aktuellen Gesetzesinitiative zur kommunalen Wärmeplanung sowie den entsprechenden Anpassungen des GEG-Entwurfs aus Sicht des VDI sehr gut reflektiert.
GEG gewährleistet Technologieoffenheit
Statt eines Verbots von Wärmeerzeugern mit fossilen Brennstoffen zu einem fixen Zeitpunkt wurde mit dem GEG ein Gesetz entwickelt, dass zum einen frühzeitig den Einstieg in klimaneutrale Wärmelösungen erleichtert und unterstützt sowie stufenweise deren Verbreitung forciert und erzwingt und zum anderen Technologieoffenheit gewährleistet. Eine schrittweise Einführung statt eines harten Nutzungsverbots ist auch sinnvoll, um die Transformation sozialverträglich zu gestalten.
Der VDI begrüßt daher, dass es nun auch bei bestehenden Gebäuden mehr um Klimaschutz geht. Allerdings suggeriert die Technologieoffenheit des GEG den Eigentümern eine große Wahlmöglichkeit, die in der Praxis unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten noch nicht erkennbar ist. Aktuell ist der Einbau einer Wärmepumpe in den meisten Fällen immer noch die sinnvollste Alternative. Ob eine Beheizung mit Wasserstoff im Jahr 2035 wirtschaftlicher ist als die Umrüstung auf Wärmepumpen, kann aus Sicht des VDI aktuell noch nicht beurteilt werden.
Einbau von Wärmepumpen bedarf einer Analyse
Es ist darauf zu achten, dass vor dem Einbau einer Wärmepumpe in ein Bestandsgebäude eine detaillierte Analyse erfolgt. Der dazu erforderliche verpflichtende hydraulische Abgleich wird vom VDI ausdrücklich als notwendig begrüßt.
Eine Wärmeerzeugung auf Basis grüner Gase oder Biokraftstoffe ist dann denkbar, wenn die ausreichende und nachhaltige Versorgung mit diesen grünen Brennstoffen nachgewiesen wird, oder diese regional zur Verfügung stehen, z. B. aus Biogasanlagen. Diese sollten dann bevorzugt im Bereich von Hochtemperaturanwendungen oder für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit gezielter Unterstützung der Versorgungssicherheit zum Einsatz kommen.
Die bauphysikalischen Eigenschaften wie Wärmedämmung, Dichtheit und Fensterqualität beeinflussen erheblich die Heizleistung. Für die Effizienz der Wärmepumpe ist die Art der Wärmeeinbringung und die Wärmequelle ausschlaggebend. Die Höhe der Betriebskosten ist wesentlich auch vom Strompreis abhängig. „Bei aller Diskussion um das Thema Energieeinsparung stehen die Menschen im Mittelpunkt und diese müssen sich in den Gebäuden wohlfühlen“, sagt Jochen Theloke, Geschäftsführer der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt.
Ausbaugeschwindigkeit der erneuerbaren Energien ist noch nicht ausreichend
Die aktuelle Ausbaugeschwindigkeit der erneuerbaren Energien ist weder im Strom- noch im Wärmesektor ausreichend, um die politischen Zielsetzungen zu erreichen. Es sind somit neben dem GEG weitere gesetzliche, regulative und ökonomische Rahmenbedingungen zu schaffen, um einen ausreichenden Ausbau der verschiedenen erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Als Instrumente kommen beispielsweise die Verteuerung von fossilen Energien durch eine EU-weit abgestimmte deutliche Erhöhung der CO₂-Abgabe und die Erhöhung der Quote für erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung im GEG infrage. “Damit würden der Ersatz fossiler Wärmeerzeuger oder die Installation von Solaranlagen bei Neubauten indirekt forciert”, so Jochen Theloke.
Quelle: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.
Auch interessant
Fortbildungs-Special: Nachhaltiges Planen und Bauen

Klimaschutz und der nachhaltige Umgang mit den Ressourcen beim Planen und Bauen sind gerade für Ingenieurinnen und Ingenieure wichtige Themen auf dem Weg zur ökologischen und digitalen Transformation der Bauwirtschaft. Hier haben wir Ihnen unsere aktuellen Fortbildungen aus den Themenfeldern Klimaschutz, nachhaltiges Planen und Bauen, BIM und Digitalisierung, Holzbau, Energieeffizienz u.v.m. zusammengestellt. Wir freuen uns, Sie in unseren Seminaren zu begrüßen!
Fortbildungstipps
Wärmepumpe – Grundlagen, Prinzip und Einsatzmöglichkeit im Kontext zur GEG Novelle
30.11.2023 09:00 - 12:30 Uhr München/Online
Energieberater:in Wohngebäude | Energieberater:in Nichtwohngebäude | Passivhaus Planer:in/Berater:in - Gesamtausbildung
16.10.2023 - 15.07.2024 München/Online
Lehrgang: Energieberater:in Wohngebäude | Passivhaus Planer:in/Berater:in
16.10.2023 - 18.03.2024 Online
Lehrgang: Zertifizierte Passivhaus Planer:in | Berater:in
16.10.2023 - 18.03.2024
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG): Rechtliche Grundlagen | Praktische Anwendung | Bilanzierung nach GEG | Förderungen (BEG)
08.01.2024 - 16.01.2024 Internet
Lehrgang: Energieberater:in Nichtwohngebäude
19.02.2024 - 15.07.2024 Online/München
Beitrag weiterempfehlen
Die Social Media Buttons oben sind datenschutzkonform und übermitteln beim Aufruf der Seite noch keine Daten an den jeweiligen Plattform-Betreiber. Dies geschieht erst beim Klick auf einen Social Media Button (Datenschutz).
Jetzt Newsletter abonnieren!

Frage des Monats
Sustainable Bavaria

Nachhaltig Planen und Bauen

Netzwerk junge Ingenieur:innen

Frauennetzwerk ingenieurinnen@bayika

Werde Ingenieur/in!

www.zukunft-ingenieur.de
Veranstaltungstipps

Einheitlicher Ansprechpartner

Berufsanerkennung
Professional recognition

Digitaltouren - Digitalforen

Anschrift
Bayerische Ingenieurekammer-Bau
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Schloßschmidstraße 3
80639 München